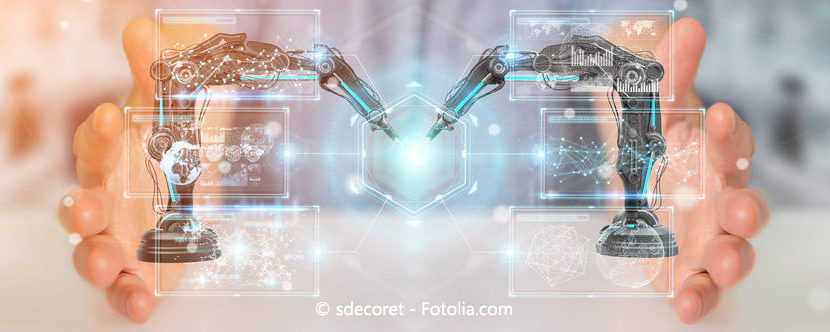Bei den Röntgenstrahlen handelt es sich um eine elektromagnetische Strahlung mit kürzeren Wellenlängen als das Licht. Sie unterscheidet sich von den Gammastrahlen und dem elektromagnetischen Bestandteil der kosmischen Strahlung nur durch die Entstehungsweise. Röntgenstrahlen sind unsichtbar, erzeugen Fluoreszenz, schwärzen Fotoplatten und können Atome ionisieren. Ähnlich Lichtstrahlen zeigen sie Reflexion, Brechung, Beugung, Interferenz und Polarisation, haben aber im Unterschied zum Licht ein hohes Durchdringungsvermögen für die meisten Stoffe. Die Röntgenstrahlung setzt sich zusammen aus der Bremsstrahlung, die beim plötzlichen Abbremsen schneller Elektronen beim Aufprall auf Materie entsteht (Ablenkung der Teilchen im elektrischen Feld der Atomkerne), und der charakteristischen Röntgenstrahlung (Eigenstrahlung, Röntgenfluoreszenzstrahlung) der Atome. Diese entsteht, wenn die kernnächsten, inneren Elektronen der Atomhülle angeregt wurden und von dem angeregten in einen energetisch tiefer liegenden Zustand zurückfallen. Die Bremsstrahlung zeigt ein kontinuierliches Spektrum, die charakteristischen Röntgenstrahlen sind Strahlen einer bestimmten Wellenlänge, im Spektrum deshalb als einzelne Linien erkennbar. Die Linien werden danach benannt, welche innere Schale beim jeweiligen Elektronenübergang »aufgefüllt« wird (K, L, M, N, … ), das K-Spektrum z. B. entsteht als Folge des Elektronenüberganges von höheren Schalen in die K-Schale. Die Frequenz der charakteristischen Röntgenstrahlen verschiebt sich nach dem Moseley-Gesetz (Moseley) mit steigender Ordnungszahl des emittierenden Atoms in den kurzwelligen Bereich. Auf Materie auftreffende Röntgenstrahlung kann Elektronen herauslösen (Röntgenfotoeffekt) oder wiederum neue Röntgenstrahlen erzeugen (sekundäre Röntgenstrahlen).
Einteilung und Anwendung:
Technisch werden Röntgenstrahlen meist mit Röntgenröhren erzeugt, wobei man ultraweiche (Wellenlängen > 1 nm), weiche (1‒0,1 nm), harte (0,1‒0,01 nm) und ultraharte (< 0,01 nm) Röntgenstrahlen unterscheidet. Die Röntgenstrahlen überschneiden sich am langwelligen Ende des Spektrums mit der UV-Strahlung Röntgen-UV (< 100 nm), bei kurzen Wellenlängen mit der Gammastrahlung. Sehr viel kurzwelligere (härtere) Röntgenstrahlen lassen sich mit Elektronenbeschleunigern (bis etwa 10-7 nm) erzeugen (Synchrotronstrahlung). Technisch nutzt man die Röntgenstrahlen v. a. in der Medizin, Metallurgie, Kristallografie und chemischen Analytik. Die für verschiedene Stoffe unterschiedliche Durchdringungsfähigkeit der Röntgenstrahlen wird besonders für medizinische Zwecke (Röntgenuntersuchung, Strahlenschäden, Strahlentherapie) und zur zerstörungsfreien Werkstoffprüfung angewandt. Weitere Verfahren zur Strukturuntersuchung sind u. a. Röntgenstrukturanalyse, Röntgenspektroskopie und Röntgenmikroskopie. ‒ Der Umgang mit Röntgenstrahlen unterliegt den Verordnungen des Strahlenschutzes. Zur Bestimmung der Dosis (Dosisleistung) von Röntgenstrahlen dienen Dosimeter.